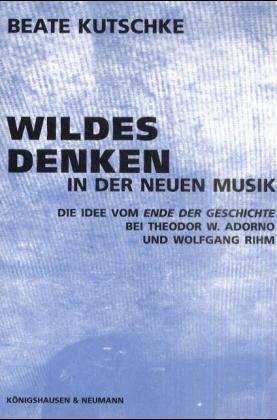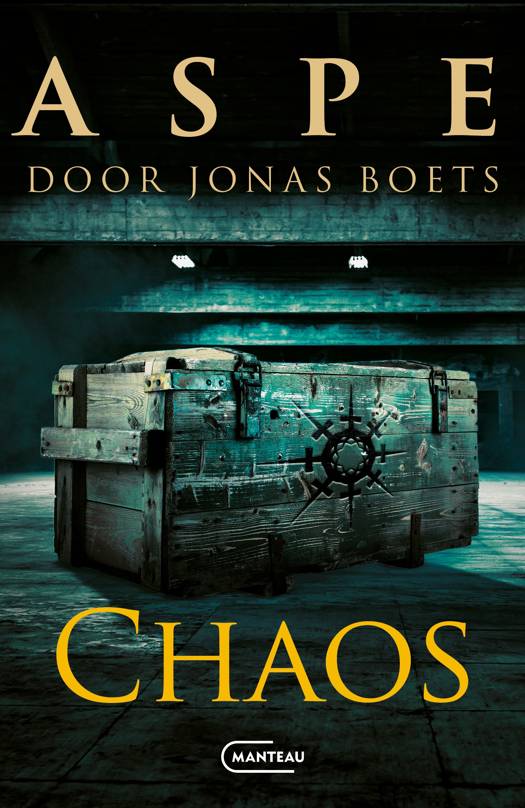
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Wildes Denken in der Neuen Musik
Die Idee vom Ende der Geschichte bei Theodor W. Adorno und Wolfgang Rihm
Beate Kutschke
Paperback | Duits
€ 43,45
+ 86 punten
Omschrijving
Was nach Lévy-Strauss typische Denkmuster der sog. Primitiven sind und was nach Foucault in Europa bis zum 16. Jahrhundert das Begreifen der Welt bestimmte, nämlich das Denken in Analogien, die Ähnlichkeitsepisteme, eben: das ,Wilde Denken' steuert auch heute noch in westlichen Kulturen menschliches Erkennen und Begreifen. Das demonstriert die Beziehung zwischen Neuer Musik und der Idee vom Ende der Geschichte.
Verschiedene Musikschriftsteller und Komponisten, allen voran Theodor W. Adorno und Wolfgang Rihm, interpretierten und konzipierten zeitgenössische Musik in Bezug auf eine technologisch dominierte, dehumanisierte und letztlich geschichtlich erstarrte Gesellschaftsverfassung - das Ende der Geschichte, wie es Soziologen und Philosophen in Schreckensvisionen entworfen hatten.
Wildes Denken in der Neuen Musik rekonstruiert die Hintergründe dieser ungewöhnlichen Beziehung zwischen Musik und dem Endgeschichtsgedanken. Es zeigt, wie in den 50er Jahren Adorno, der eigentliche Urheber der Musik-Endgeschichtsbeziehung, sein Aufsehen und Protest erregende Kritik der Neuen Musik auf die Idee vom Ende der Geschichte stützte, indem er auf strukturelle Ähnlichkeiten zwischen seriellen Kompositionstechniken und einer endgeschichtlichen Weltverfassung hinwies. Adornos Kritik blieb nicht ohne Konsequenzen. Obwohl die strukturellen Gemeinsamkeiten den verglichenen Phänomenen - der Musik und dem Endgeschichtsgedanken - lediglich äußerlich sind, verlieh die Ähnlichkeitsepisteme Adornos Argumentation soviel Plausbilität, daß in den 70er und 80er Jahren Komponisten wie Wolfgang Rihm und Luigi Nono Musik ,gegen die endgeschichtliche Bedrohung' schrieben.
Verschiedene Musikschriftsteller und Komponisten, allen voran Theodor W. Adorno und Wolfgang Rihm, interpretierten und konzipierten zeitgenössische Musik in Bezug auf eine technologisch dominierte, dehumanisierte und letztlich geschichtlich erstarrte Gesellschaftsverfassung - das Ende der Geschichte, wie es Soziologen und Philosophen in Schreckensvisionen entworfen hatten.
Wildes Denken in der Neuen Musik rekonstruiert die Hintergründe dieser ungewöhnlichen Beziehung zwischen Musik und dem Endgeschichtsgedanken. Es zeigt, wie in den 50er Jahren Adorno, der eigentliche Urheber der Musik-Endgeschichtsbeziehung, sein Aufsehen und Protest erregende Kritik der Neuen Musik auf die Idee vom Ende der Geschichte stützte, indem er auf strukturelle Ähnlichkeiten zwischen seriellen Kompositionstechniken und einer endgeschichtlichen Weltverfassung hinwies. Adornos Kritik blieb nicht ohne Konsequenzen. Obwohl die strukturellen Gemeinsamkeiten den verglichenen Phänomenen - der Musik und dem Endgeschichtsgedanken - lediglich äußerlich sind, verlieh die Ähnlichkeitsepisteme Adornos Argumentation soviel Plausbilität, daß in den 70er und 80er Jahren Komponisten wie Wolfgang Rihm und Luigi Nono Musik ,gegen die endgeschichtliche Bedrohung' schrieben.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 338
- Taal:
- Duits
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783826022432
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 155 mm x 236 mm
- Gewicht:
- 546 g
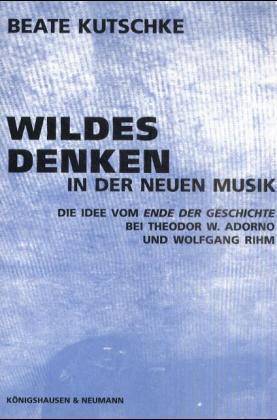
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 86 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.