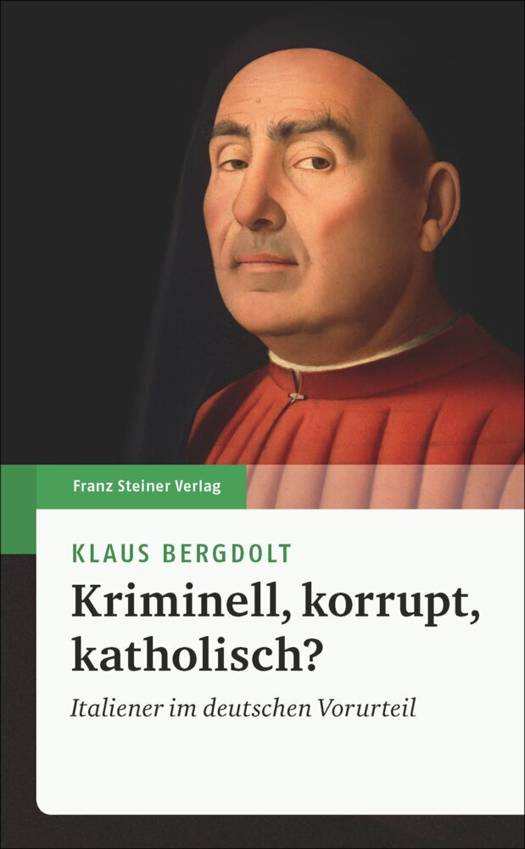Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
€ 35,45
+ 70 punten
Omschrijving
Goethe sah in seiner Italienreise 1786/87 den Hohepunkt seines Lebens. Viele Schriftsteller deutscher Sprache ausserten sich ahnlich und bekundeten, dass ihr Werk und ihr Denken entscheidend, und zwar im positivsten Sinn, durch Italien gepragt wurde. Gleichzeitig jedoch blickten deutsche Intellektuelle jahrhundertelang mit einem Gefuhl moralischer und kultureller Uberlegenheit auf die Italiener herab. So sehr man die Landschaft und die Kunst des Sudens vergottlichte, die Venezianer, Florentiner, Romer oder Sizilianer selbst wurden in der Regel kritisch gesehen, wobei der antiitalienische Diskurs von negativen Stereotypen bestimmt wurde. Klaus Bergdolt geht dieser erstaunlichen Ambivalenz auf den Grund, die zwischen demonstrativer Begeisterung fur italienische Kunst und Geschichte und einem Uberlegenheitsgefuhl schwankt, das im 19. Jahrhundert sogar pseudowissenschaftlich untermauert wurde und bis heute fortwirkt.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 243
- Taal:
- Duits
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783515121231
- Verschijningsdatum:
- 18/10/2018
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 130 mm x 211 mm
- Gewicht:
- 416 g
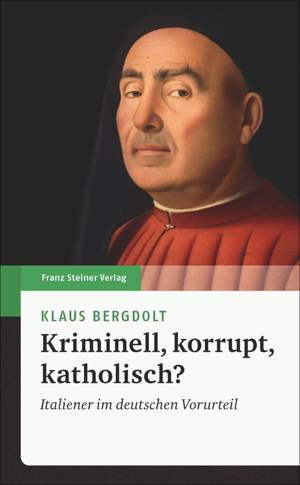
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 70 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.