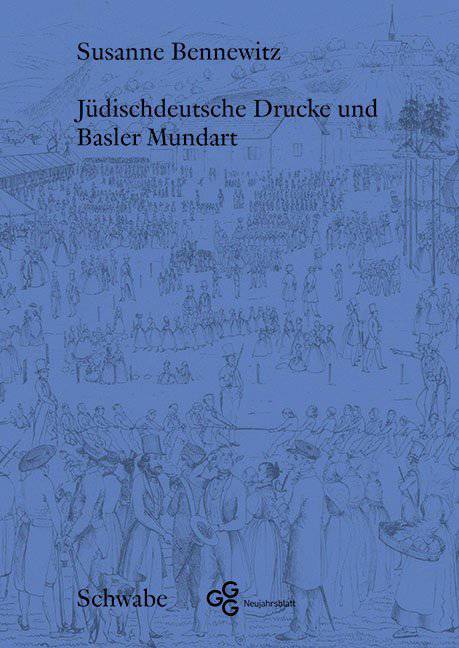- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Judischdeutsche Drucke Und Basler Mundart
Judische Sprachen in Basel Zu Beginn Der Emanzipation
Susanne Bennewitz
Paperback | Duits | Neujahrsblatt der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige, Basel GGG | nr. 196
€ 72,95
+ 145 punten
Omschrijving
English summary: How did the linguistic integration of ethnic groups, which were shaped by the united educational ideals and a centralized government, function in the nation-states of the 19th century? The author of this study shows through the methods of linguistic history, how we ourselves can represent the linguistic conversions of the past but also see the flexibility that exists in daily communication, even within formal processes. This study shows that the Jews in the French region around Basel first took their citizen's oath to the French king in German and contrasted the pronunciation rules for Basler schoolchildren at the beginning of compulsory education with those of the Jewish linguistic educators. Within the boundaries of a political linguistic history and the discourse about language, Susanne Bennewitz bases her study on the social-linguistic observations and insightful transcriptions from Jewish documents. For the first time, the Hebrew spelling for German texts is extensively examined and the print media history meaning for Jewish Germans in Basle is brought to life. German description: Wie funktionierte die sprachliche Integration von Bevolkerungsgruppen in den Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts, die von einheitlichen Bildungsidealen und einer zentralisierten Verwaltung gepragt waren? Mit einer Sprachgeschichte von unten zeigt die Autorin, wie wir uns die sprachliche Annaherung, aber auch die Flexibilitat in der Alltagskommunikation etwa bei amtlichen Vorgangen, vorstellen konnen. Sie weist nach, dass die Juden im franzosischen Vorort von Basel ihren ersten Burgereid auf den franzosischen Konig auf Deutsch ablegten, und vergleicht die Ausspracheregeln fur Basler Schulkinder zu Beginn der allgemeinen Schulpflicht mit denen der judischen Spracherzieher. In Abgrenzung zu einer politischen Sprachgeschichte und dem Diskurs uber Sprachen stutzt Susanne Bennewitz ihre Studie auf soziolinguistische Beobachtungen und aufschlussreiche Transkriptionen von judischdeutschen Dokumenten. Erstmals wird die hebraische Schreibweise fur hochdeutsche Texte ausfuhrlich erlautert und die mediengeschichtliche Bedeutung der judischdeutschen Basler Drucke beschrieben. Mit ihrer lebendigen Darstellung fuhrt die Autorin zugleich in die judische Kulturgeschichte im Basel des 19. Jahrhunderts ein. Insbesondere wird so nachvollziehbar, wie sich die judische Aufklarung in Preussen und die judische Gleichberechtigung in Frankreich auf die Sprachpraxis und -ideale in Basel auswirkten. Die fachkundige Bebilderung der Studie bietet einen anschaulichen Einstieg in alle Kapitel und Fachbegriffe und fuhrt Sach- und Schriftkultur unter neuen Gesichtspunkten zusammen.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 186
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 196
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783796537622
- Verschijningsdatum:
- 30/11/2017
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 170 mm x 270 mm
- Gewicht:
- 412 g
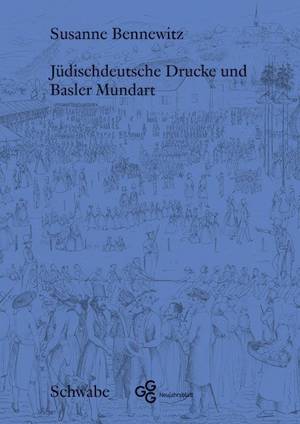
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 145 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.