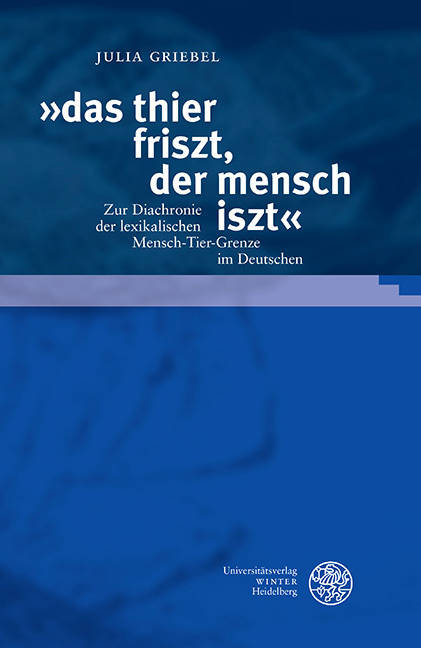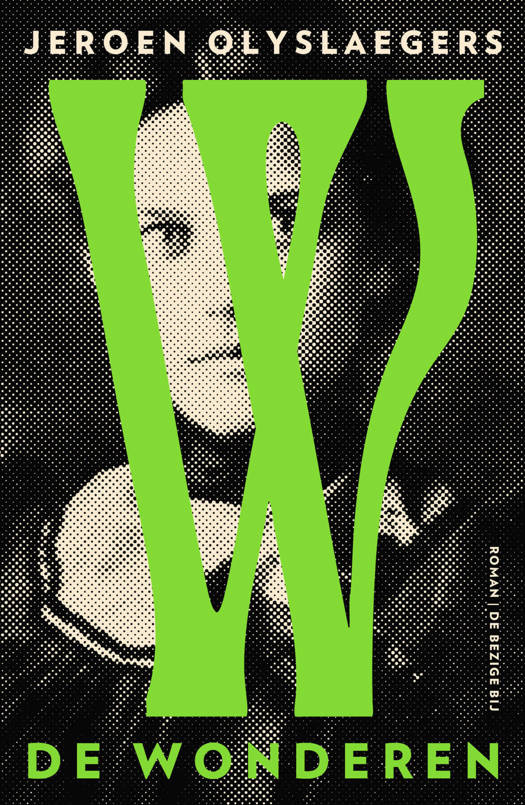
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Das Thier Friszt, Der Mensch Iszt
Zur Diachronie Der Lexikalischen Mensch-Tier-Grenze Im Deutschen
Julia Griebel
€ 101,95
+ 203 punten
Omschrijving
Tiere fressen, Menschen essen: Eine lexikalische Trennung zwischen Mensch und Tier ist im Deutschen heute selbstverstandlich. Sie wird bei zahlreichen Sachverhalten gezogen, die Mensch und Tier gemein sind, und meist strikt eingehalten, so etwa bei Nahrungs- und Flussigkeitsaufnahme ('essen'/'fressen', 'trinken'/'saufen', 'stillen'/'saugen'), Schwangerschaft ('schwanger'/'trachtig), Geburt ('gebaren'/'werfen'), Tod ('sterben'/'verenden', 'ermorden'/'schlachten'), Lebewesenbezeichnungen ('Saugling', 'Baby'/'Junges', 'Leiche'/'Kadaver' u. a.) und Korperteilen ('Mund'/'Maul', 'Lippe'/'Lefze' u. a.). Hierbei handelt es sich um eine sprachhistorisch relativ junge Entwicklung, die vollstandig erst im Neuhochdeutschen vollzogen wurde und in anderen Sprachen bis heute nicht existiert. Die Arbeit untersucht diese lexikalische Grenzziehung zwischen Mensch und Tier sprachgeschichtlich anhand von Worterbuch- und Korpusstudien vom Althochdeutschen bis zum Gegenwartsdeutschen. Sie verfolgt die Herausbildung dieser Grenze sprachgeschichtlich und erklart sie kulturhistorisch.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 294
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 69
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783825346911
- Verschijningsdatum:
- 13/04/2020
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 165 mm x 244 mm
- Gewicht:
- 638 g

Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 203 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.