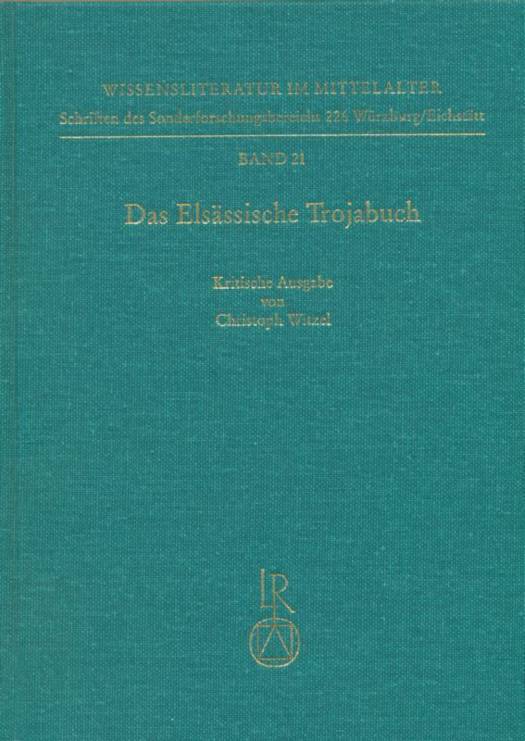Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
€ 91,95
+ 183 punten
Omschrijving
Mit dieser kritischen Ausgabe wird der Roman das "Elsassische Trojabuch", der Ende des 14. Jahrhunderts geschrieben wurde, der wissenschaftlichen Offentlichkeit erstmals vollstandig bekannt gemacht. Es handelt sich um die mit 15 Textzeugen am weitesten verbreitete Prosabearbeitung des Trojastoffes im Spatmittelalter. Mit einer Entstehungszeit vor 1386 (moglicherweise schon vor 1382) liegt hier - abgesehen von singularen Erscheinungen - der alteste deutsche Prosaroman uberhaupt vor. Der Text fuhrte bislang den Namen "Buch von Troja I", wird aber vom Herausgeber aufgrund neuerer Untersuchungen nun als "Elsassisches Trojabuch" bezeichnet. Der Autor des Romans, der im Spatmittelalter stark rezipiert wurde, ist unbekannt; die Prosabearbeitung des Trojastoffes stutzt sich auf drei Quellen: auf den "Trojanerkrieg" Konrads von Wurzburg, auf "De excidio Troiae historia" des Dares Phrygius und die "Historia Destructionis Troiae" von Guido de Columnis. Die handschriftliche Uberlieferung reicht zeitlich vom Ende des 14. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts und raumlich vom Strassburger Raum bis ins Ostbairische.Die Untersuchung der 15 Textzeugen fuhrt zu einem klar gegliederten, zweistrangigen Stemma, das dem Herausgeber als eine von zwei wichtigen textkritischen Stutzen dient. Die zweite Stutze besteht in der Quellenargumentation und fusst auf der Erkenntnis, dass sich der Autor prinzipiell eng an Handlungsfuhrung und Wortwahl seiner Vorlagen anlehnte. Mit Hilfe des Stemmas, der Uberlieferungs- und Textgeschichte sowie der Quellenargumentation rekonstruiert der Herausgeber auf der Basis einer Leithandschrift (Berlin, SBPK, Mgf 59) den Archetypus des Romans. Damit kann dem Benutzer ein Text an die Hand gegeben werden, der der literarhistorischen Bedeutung des "Elsassischen Trojabuchs" gerecht wird.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 296
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 21
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783882268492
- Verschijningsdatum:
- 6/11/1995
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 170 mm x 240 mm
- Gewicht:
- 706 g
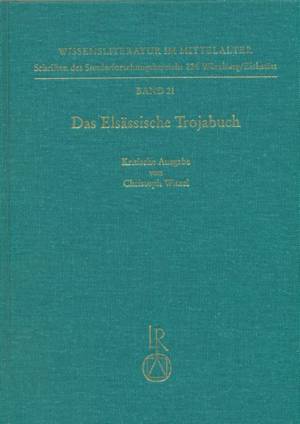
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 183 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.