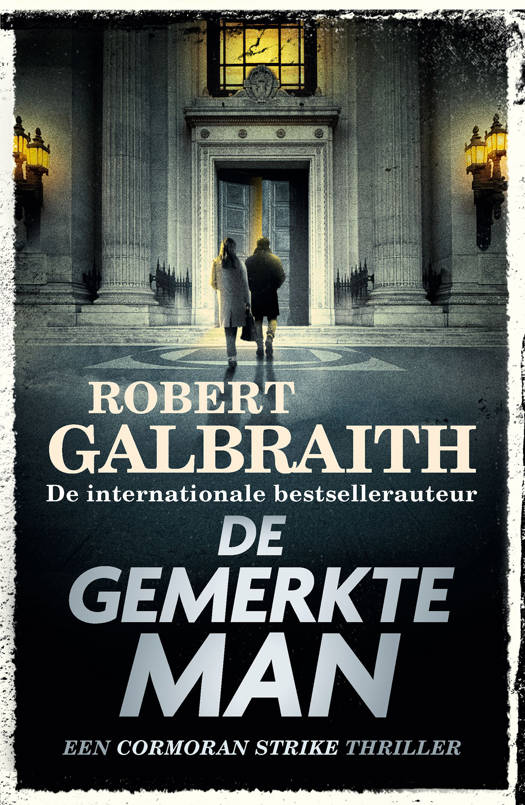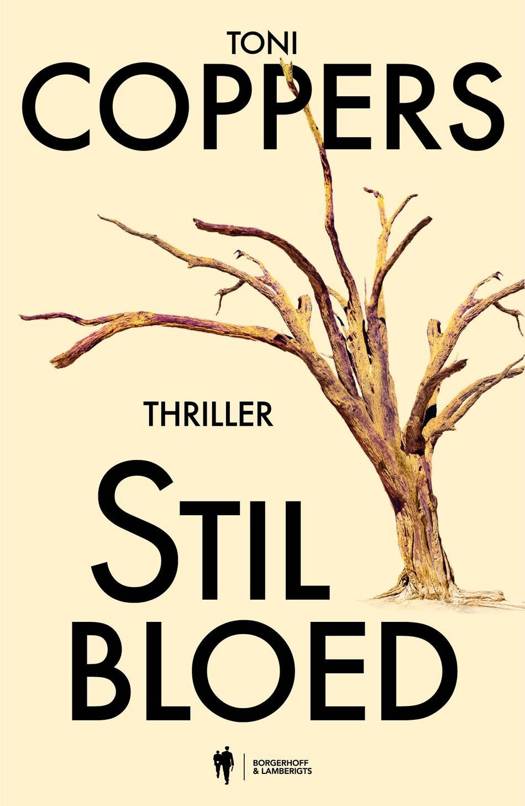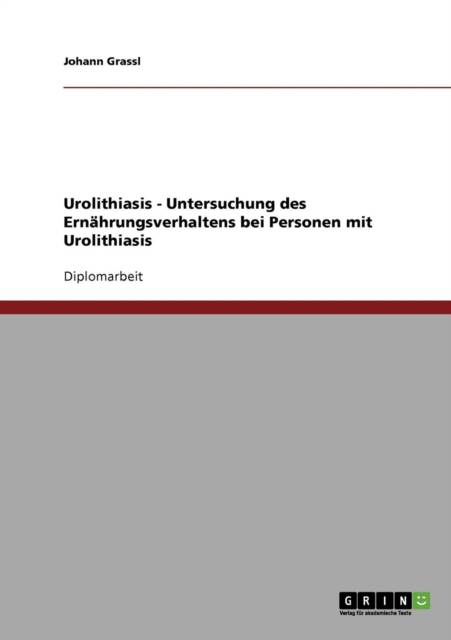- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Urolithiasis - Untersuchung des Ernährungsverhaltens bei Personen mit Urolithiasis
Johann Grassl
Paperback | Duits
€ 28,95
+ 57 punten
Omschrijving
Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Gesundheit - Ernährungswissenschaft, Note: 1, Sprache: Deutsch, Abstract: UROLITHIASIS Untersuchung des Ernährungsverhaltens bei Personen mit Urolithiasis am Beispiel von Patienten des Allgemein Öffentlichen Krankenhauses der Landeshauptstadt St. Pölten. Urolithiasis ist eine Erkrankung, die bereits seit dem Altertum bekannt ist. Schon in ägyptischen Mumien konnten Nieren- und Blasensteine nachgewiesen werden. Seit den letzten 25 Jahren tritt das Harnsteinleiden immer öfter auf. Am häufigsten sind Erwachsene im Alter zwischen dem 30sten und 50sten Lebensjahr betroffen. 50% aller Steinpatienten sind Rezidivbildner. Die alleinige Therapie durch Harnsteinzertrümmerung, Auflösung, Extraktion oder operative Entfernung ist daher nicht genug. Um Urolithiasis wirksam behandeln zu können, muss mehr Wert auf Steinverhütung bzw. Steinprophylaxe gelegt werden. Eine Heilung des Steinleidens durch Diät ist nicht möglich. Mittels Steinanalyse und Kenntnis der Steinpathogenese ist es durch gezielte diätetische Maßnahmen möglich, eine erneute Steinbildung zu verzögern oder zu verhindern. Durch konsequente Anwendung prophylaktischer Maßnahmen lässt sich die Rezidivrate von 50% auf 10% senken. Im ersten Teil der Arbeit werden Entstehung und Behandlung von Harnsteinen sowie die Prophylaxemöglichkeiten beschrieben. Im zweiten Teil wird mittels Fragebogen und anhand von Laborparametern das Ernährungsverhalten, Schlafgewohnheiten, Freizeitverhalten und das Ernährungswissen von Harnsteinpatienten, des A. Ö. Krankenhauses St. Pölten, überprüft. In der Arbeit werden folgende Fragen analysiert und diskutiert: Sind Harnsteinpatienten übergewichtig? Essen Harnsteinpatienten, deren Harn-pH zu sauer ist, zu viel tierisches Eiweiß? Trinken Harnsteinpatienten zu wenig? Gibt es Zusammenhänge zwischen der Lokalisation von Harnsteinen und der bevorzugten Schlafposition? Wie gut ist der Wissensstand von Harnsteinpatienten im Bezug auf notwendige Ernä
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 84
- Taal:
- Duits
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783638709217
- Verschijningsdatum:
- 14/08/2007
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 148 mm x 210 mm
- Gewicht:
- 122 g

Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 57 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.