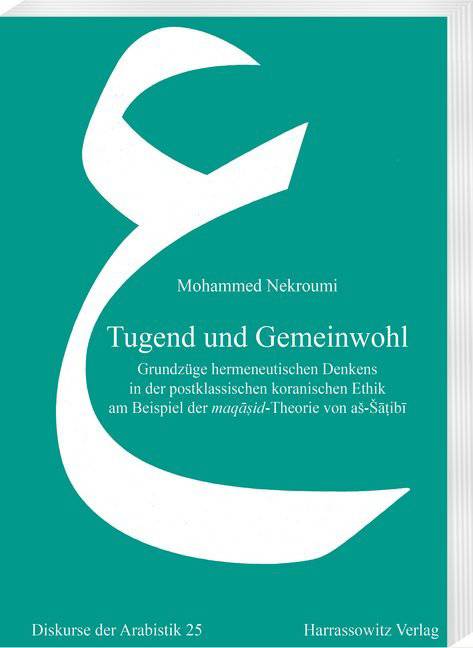Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Tugend Und Gemeinwohl
Grundzuge Hermeneutischen Denkens in Der Postklassischen Koranischen Ethik Am Beispiel Der Maqasid-Theorie Von As-Satibi
Mohammed Nekroumi
€ 120,95
+ 241 punten
Omschrijving
Die moderne Debatte um Bedeutung und Anliegen des Begriffs sari'a ging seit Beginn des 20. Jahrhundert mit der Frage nach Bestandigkeit, Allgemeingultigkeit und Wandelbarkeit koranischer Moralnormativitat einher. Wahrend sich eine Vielzahl unsystematischer popularwissenschaftlicher Erklarungsansatze mit der vermeintlichen Krise islamischer Moralitat beschaftigten, blieb der theologisch-akademische Diskurs zu den grundliegenden zeitgenossischen Fragen islamischer Ethik weitgehend unterentwickelt, mit der Begrundung, er sei angesichts der Bildungsferne des muslimischen Empfangers nicht kommunikabel. Und bis heute findet man kaum Studien, die sich ideengeschichtlich und epistemologisch mit Blick auf die ganze Bedeutungstiefe islamisch-ethischer Begriffe und den Wandel des normativen Konzepts der sari'a in den unterschiedlichen Epochen der islamischen Geistesgeschichte befassen. Ausgehend von einer erkenntnistheoretischen Auseinandersetzung mit der Ethiktheorie der sogenannten maqasid, die die Ziele der sari'a bzw. die Intentionen des Gesetzgebers zum Gegenstand hat, unternimmt Mohammed Nekroumi einen Rekonstruktionsversuch zur Verhaltnisbestimmung zwischen islamischer Moralitat und Ethikfragen der Moderne wie Gewissen, Freiheit, Verantwortlichkeit, Tugend oder Gluckseligkeit. Im Mittelpunkt der theologisch-hermeneutischen Reflexion steht dabei das Werk des andalusischen Universalgelehrten Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa as-satibi (gest. 790/1388), das die Blutezeit und die epistemologische Reife der islamischen theologischen Ethik kennzeichnet.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 228
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 25
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783447109581
- Verschijningsdatum:
- 14/02/2018
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 172 mm x 240 mm
- Gewicht:
- 479 g
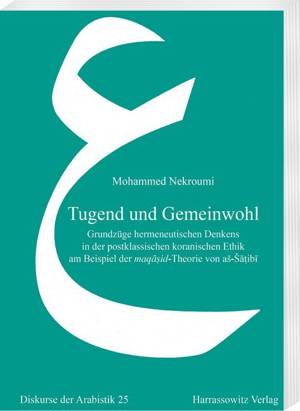
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 241 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.