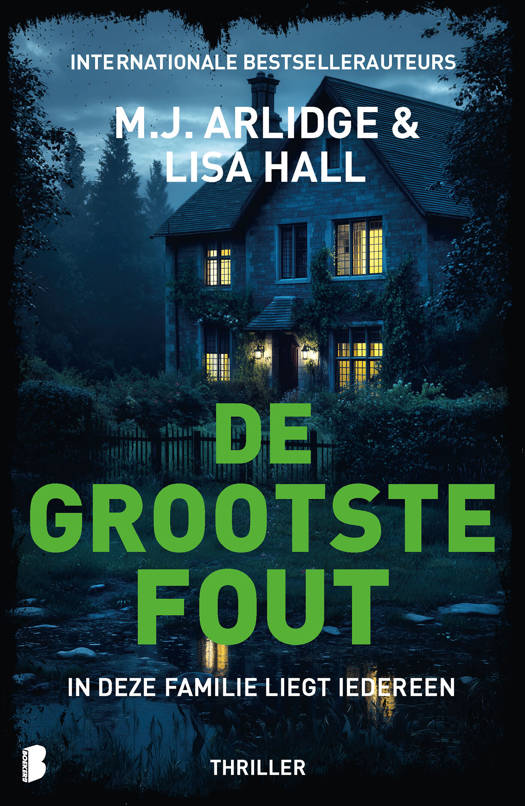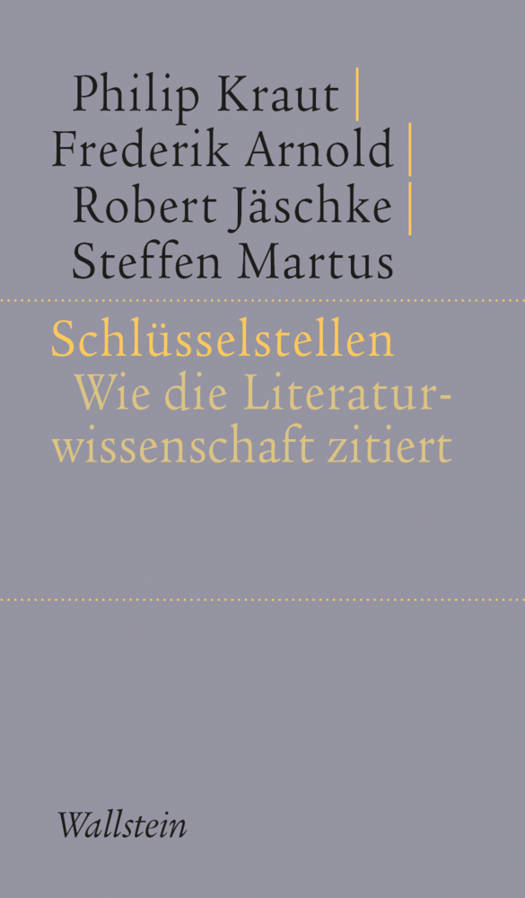- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Schlüsselstellen
Wie die Literaturwissenschaft zitiert
Frederik Arnold, Robert Jäschke, Philip Kraut, Steffen Martus
€ 14,95
+ 29 punten
Omschrijving
Menschen interpretieren Texte ungleichmäßig. Sie messen einigen Stellen eine größere Bedeutung zu als anderen. Worauf richtet sich die Aufmerksamkeit, wie geschieht dies und was sind die Gründe dafür?Menschen interpretieren Texte ungleichmäßig und messen einigen Stellen eine größere Bedeutung zu als anderen. Hermeneutische Könnerschaft besteht nicht zuletzt darin, während der laufenden Arbeit zu bemerken, aus welchen Stellen sich etwas machen lässt: Welche der vielen während der Lektüre im Gedächtnis bewahrten, durch Randbemerkungen hervorgehobenen oder im Exzerpt festgehaltenen Textteile sollen genauer behandelt werden, um Anspruch auf eine Deutung des Textganzen zu erheben? Wie geschieht dies in literaturwissenschaftlichen Interpretationen? Und inwiefern liegen die Gründe dafür im literarischen Werk oder doch eher in den sozialen Konventionen?Die Studie nutzt quantitative Verfahren, um den Umgang mit »Schlüsselstellen« besser zu verstehen und sucht damit Antworten auf kanonische Fragen der Literaturtheorie. Am Beispiel eines umfangreichen Korpus von Interpretationstexten zu Annette von Droste-Hülshoffs »Die Judenbuche« und Heinrich von Kleists »Michael Kohlhaas« zeichnet sich dabei die unterschiedliche Deutungspraxis von zwei Interpretationsgemeinschaften ab. Zugleich aber zeigen sich geteilte Standards, die Fragestellungen und Theorieneigungen übergreifen. Vielfach, so scheint es, besteht kein Deutungs-, aber ein bemerkenswerter Beachtungskonsens.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 13
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783835360853
- Verschijningsdatum:
- 15/05/2026
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 123 mm x 210 mm
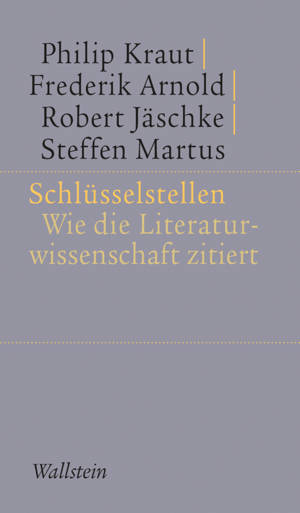
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 29 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.