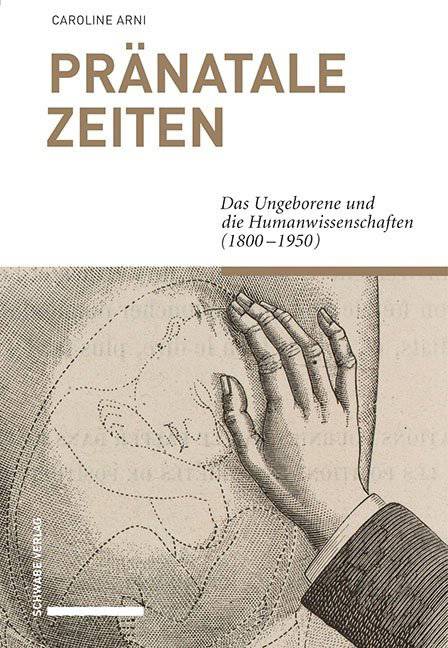- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Pranatale Zeiten
Das Ungeborene Und Die Humanwissenschaften (1800-1950)
Caroline Arni
Paperback | Duits
€ 58,45
+ 116 punten
Uitvoering
Omschrijving
Im spaten 19. Jahrhundert machten franzosische Psychiater eine alarmierende Beobachtung: Bei Kindern, die wahrend der preussischen Belagerung und der blutigen Revolten in Paris 1870/71 gezeugt worden waren, zeigten sich gehauft korperliche und psychische Anomalien. Das liess aufhorchen: Wie hatten die turbulenten Ereignisse jener Zeit eine solch fatale Wirkung uber Generationen hinweg entfaltet? Als mogliche Faktoren wurden neben den schwierigen Lebensumstanden vor allem die traumatischen Erfahrungen der Schwangeren in Betracht gezogen. Ausgehend von dieser Episode untersucht Caroline Arni, wie Physiologen, Mediziner und Psychologen im 19. Jahrhundert ihren Blick auf das Geschehen vor der Geburt richteten, indem sie das Leben des Fotus zum Gegenstand von Experiment und Beobachtung machten. Aus diesen Forschungen ging zum einen das gesundheitspolitisch brisante Konzept der pranatalen Pragung hervor. Zum andern warf die Ergrundung fotaler Entwicklung eine gewichtige Frage auf: Beginnt menschliche Subjektivitat vor oder nach der Geburt? Pranatale Zeiten leistet einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Wissenschaften und der Schwangerschaft. Als sich im 19. Jahrhundert die Wissenschaften vom Leben und jene vom Menschen herausbildeten, wurde das Ungeborene nicht nur als Embryo Gegenstand biologischen Wissens, sondern forderte als Vorgeburtliches auch die Humanwissenschaften heraus. Indem das Buch diesen bisher wenig bekannten Aspekt in der Geschichte des Ungeborenen ausleuchtet, eroffnet es neue Blickwinkel auf heute virulente Fragen: Es verleiht den bioethischen Debatten um den Beginn menschlichen Lebens eine historische Dimension und skizziert die Anfange aktueller Forschungen zur pranatalen Pragung, die heute neben genetischen und sozialen Faktoren als dritte eigenschaftsbildende Kraft gilt.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 307
- Taal:
- Duits
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783757400033
- Verschijningsdatum:
- 31/08/2018
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 154 mm x 221 mm
- Gewicht:
- 489 g
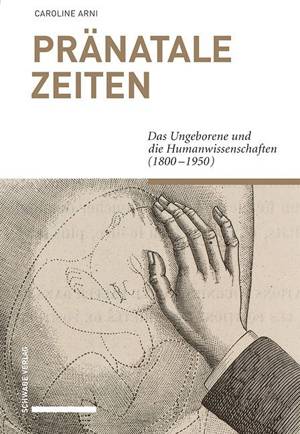
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 116 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.