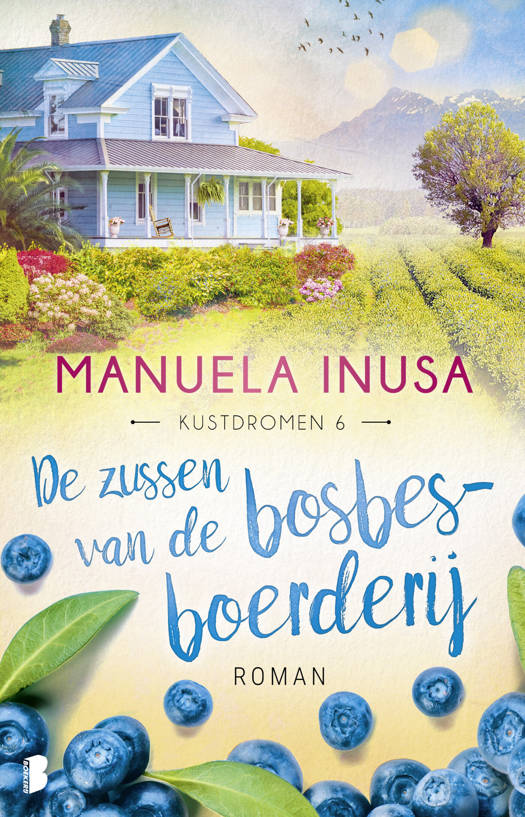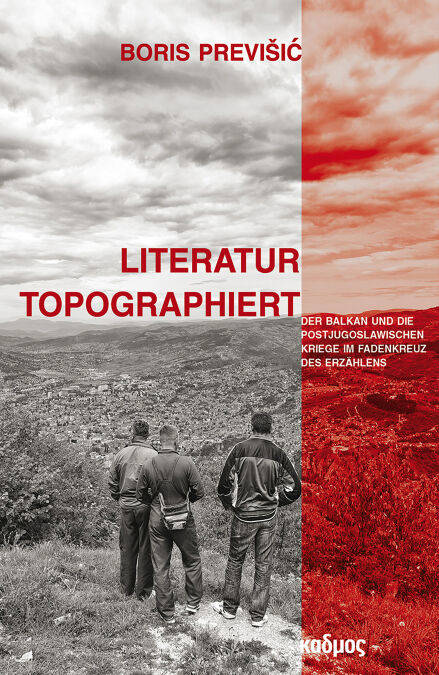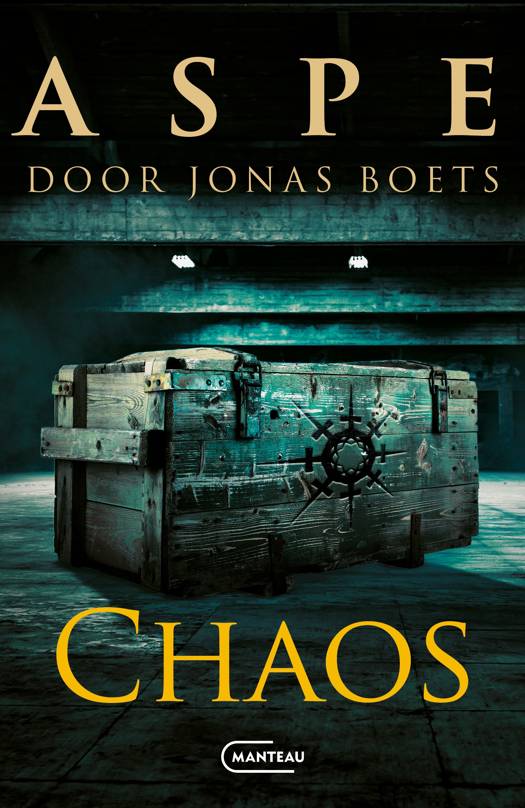
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Literatur topographiert E-BOOK
Der Balkan und die postjugoslawischen Kriege im Fadenkreuz des Erzählens
Boris Previšić
€ 24,99
+ 24 punten
Uitvoering
Omschrijving
Die postjugoslawischen Kriege haben das Friedensprojekt Europa in seinen Grundfesten erschüttert. Das neu erstandene stereotype Bild vom Balkan hat aber ebenso sehr mit der historischen Implikation Österreichs und Deutschlands zu tun. Darum wird gleich eingangs Diskursbildung und konkretes Kriegsgeschehen miteinander verschränkt, um die literarische Verarbeitung der jüngsten Kriege erstmals aus einer Doppelperspektive von ›innen‹ und ›außen‹ zu analysieren. Dabei steht die Frage im Zentrum, wie die Literatur durch die kriegsversehrte Landschaft topographiert wird und wie sie selber diese wiederum topographiert. Augenzeugenberichte kritisieren nicht nur einschlägige Diskurse, wie z.B. den »Clash of Civilizations«, sondern akzentuieren genuin literarische Verfahren, um das Trauma überhaupt benennen zu können. Dagegen nimmt sich die Außenperspektive geradezu bescheiden aus, ist man doch im deutschsprachigen Raum zunächst mit sich selber beschäftigt. Dennoch sind aus komparatistischer Sicht Parallelen auszumachen. Dazu gehört der Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg. Während sich Sebald einer melancholischen Dekadenzgeschichte verschreibt, ist bei Autoren Ex-Jugoslawiens (Albahari, Drakulić, Karahasan) ein ungebrochener Wille erkennbar, aus der Geschichte lernen zu wollen. Bei der jüngsten Generation (Gstrein, Stanišić, Hemon, Kim) wird ein metanarratives Erzählen immer wichtiger. Aus der Abgleichung von Reisebewegung und verhandelten Topoi lässt sich anhand der postjugoslawischen Kriege eine Raumnarratologie entwickeln, die bereits für die Analyse von Handkes polemischen Schriften gebraucht und gegen Schluss der Monographie bis hin zur Gedichtanalyse (Stojić, Dežulović, Waterhouse) immer zentraler wird. Damit wird erstmals der Versuch unternommen, aus einer Gesamtsicht die literarische Rezeption des jüngsten Traumas der europäischen Geschichte nachhaltig aufzuarbeiten.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 480
- Taal:
- Duits
- Reeks:
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783967500776
- Verschijningsdatum:
- 9/09/2025
- Uitvoering:
- E-book
- Beveiligd met:
- Digital watermarking
- Formaat:
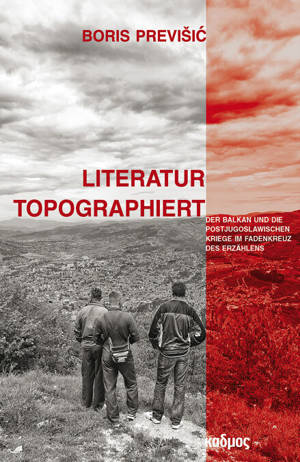
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 24 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.