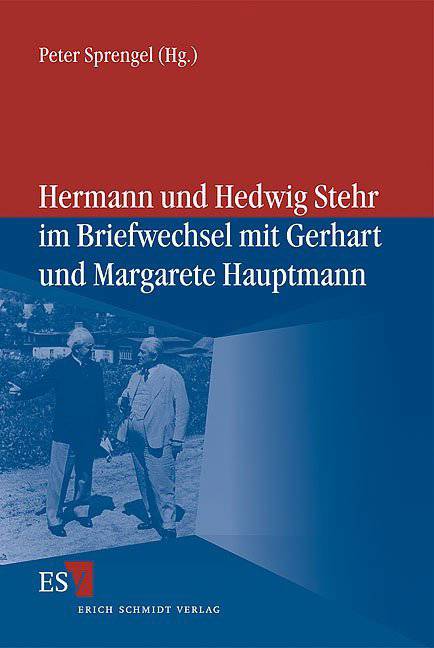- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Hermann und Hedwig Stehr im Briefwechsel mit Gerhart und Margarete Hauptmann
€ 43,45
+ 86 punten
Omschrijving
Die Schriftsteller Hermann Stehr (1864-1940) und Gerhart Hauptmann (1862-1946) verband seit 1898 eine persönliche Beziehung, phasenweise sogar eine enge Freundschaft. Ausgangspunkt und inneres Zentrum ihrer Partnerschaft war die gemeinsame Suche nach einem literarischen Stil jenseits des Naturalismus. Stehrs radikal-visionäre Erzählprosa stand in innerer Entsprechung zu den neoromantischen Schreibversuchen Hauptmanns nach 1900 und seiner Hinwendung zum griechischen Mythos; mit den Romanen "Der Narr in Christo Emanuel Quint" (Hauptmann) und "Der Heiligenhof" (Stehr) erreicht die Dichterfreundschaft auch inhaltlich, nämlich in der gemeinsamen Thematisierung religiöser Erfahrungen, sichtbaren Ausdruck.Mit der danach einsetzenden Anerkennung Stehrs als "hervorragendster der gegenwärtig in Deutschland wirkenden Prosadichter" (Rathenau, 1919) verdichten sich allerdings die Spannungen zwischen dem dichtenden Volksschullehrer im schlesischen Pohldorf (später Bad Warmbrunn und Mittel-Schreiberhau) und seinem zunächst ungleich berühmteren Entdecker, Freund und Mäzen in Agnetendorf (bzw. Hiddensee oder Oberitalien). Diese Spannungen sind nicht zuletzt politisch, nämlich im beiderseitigen Anspruch auf Repräsentanz des schlesischen Geistes, begründet und verschärfen sich nach der Inanspruchnahme Stehrs durch die NS-Kulturpolitik nach 1933.Die Erstedition des Briefwechsels, die wesentlich auf dem Briefnachlass Hauptmanns beruht, ergänzt den Dialog der Dichter um den Part der Ehefrauen: Die Geigerin Margarete Hauptmann lässt sich vom musikhungrigen Verfasser der "Geschichten aus dem Mandelhause" charmant umwerben; Hedwig Stehr bringt dagegen die Perspektive des häuslichen Alltags ein, bevor sie in geistiger Verwirrtheit Liebesbriefe an das frühere Idol ihres Mannes richtet.Eine umfangreiche biographische und literaturwissenschaftliche Einleitung rekonstruiert die Geschichte der Beziehung beider Autoren unter der Überschrift "Brüder im heiligen Geist? Tragik einer Dichter-Freundschaft". Ein mehrteiliger Anhang beschließt den Band, der wichtige Aufschlüsse sowohl für die Entwicklung der postnaturalistischen Literatur als auch für die schlesische Geistesgeschichte der Moderne liefert.
Specificaties
Betrokkenen
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 262
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 14
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783503098521
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 235
- Gewicht:
- 424 g

Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 86 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.