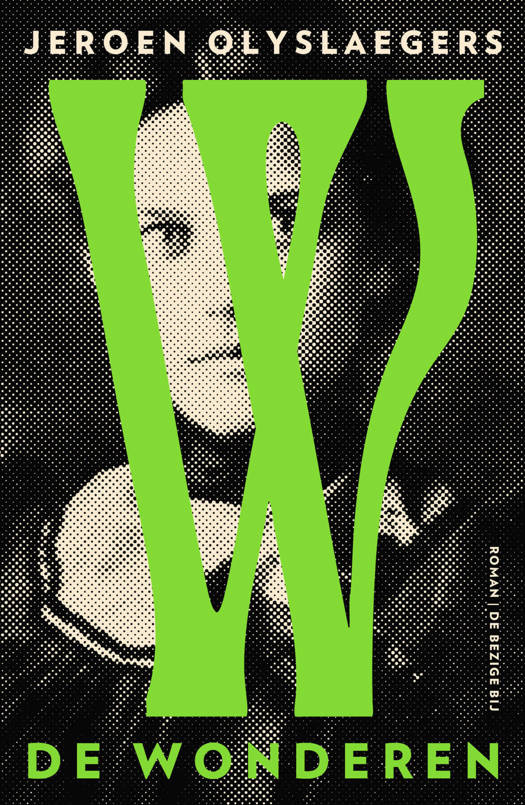
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Glaube Und Gegenwart
Die Entwicklung Der Kirchenpolitischen Netzwerke in Wurttemberg Um 1968
Karin Oehlmann
€ 205,45
+ 410 punten
Omschrijving
Karin Oehlmann beschreibt, ausgehend von der heutigen kirchenpolitischen Landschaft in Wurttemberg, die in Gesprachskreise und Landesvereinigungen gegliedert und vom Gegensatz zwischen Pietismus und moderner Theologie gepragt ist, die grossen Konflikte in der Landeskirche sowie die Geschichte der beteiligten Gruppen.Zunachst werden die Entstehungsgeschichten der Ludwig-Hofacker-Vereinigung (heute: Lebendige Gemeinde Christusbewegung in Wurttemberg), der Wurttembergischen Bekenntnisgemeinschaft (heute: Evangelium und Kirche) und jener progressiv und reformerisch orientierten Gruppen, aus denen spater die 'Offene Kirche' hervorging, beschrieben. Grundlegend fur die Entwicklung zwischen 1945 und 1965 war dabei der Konflikt um die sog. Moderne Theologie bzw. das Entmythologisierungskonzept Rudolf Bultmanns. Diese Theologie wurde von biblisch-konservativer Seite massiv bekampft, wahrend die reformorientierten Krafte darin die angemessene Form theologischen Denkens und Verkundigens im 20. Jahrhundert sahen und sie verteidigten.Die Netzwerke, die sich um die theologische Frage der bekenntnisgemassen Exegese gebildet hatten, suchen ihre Anliegen u.a. mit den Mitteln der Kirchenpolitik und uber die Landessynode durchzusetzen. Dies fuhrte zu einer Polarisierung der synodalen Arbeit, was 1966 in der Entstehung der 'Gesprachskreise' in der Wurttembergischen Landessynode seinen klarsten Ausdruck fand.Im Vorfeld des Kirchentags 1969 spitze sich der Konflikt zwischen diesen Lagern massiv zu, da es um Teilnahme oder Boykott der pietistisch-evangelikalen Gruppen ging. Diese Auseinandersetzung fuhrte im Herbst 1968 zum Rucktritt des Synodalprasidenten Oskar Klumpp. Auf diesen Rucktritt reagierten die progressiven Krafte in Wurttemberg mit der Grundung der 'Kritischen Kirche', aus der spater die 'Offene Kirche' hervorging.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 461
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 62
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783525557778
- Verschijningsdatum:
- 7/03/2016
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 168 mm x 236 mm
- Gewicht:
- 851 g

Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 410 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.








