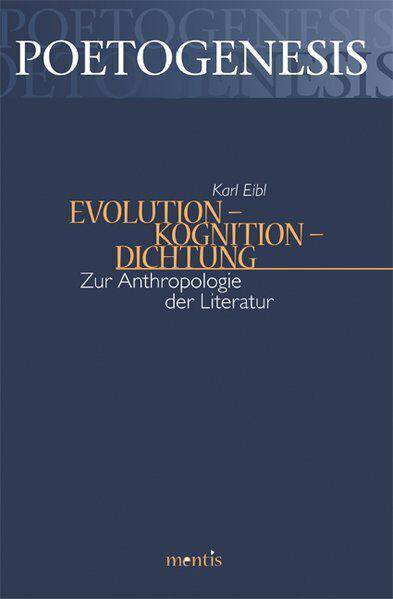Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Omschrijving
Die Literaturwissenschaft widmet sich seit einigen Jahren verstärkt dem Zusammenhang von Kognition und Dichtung. Dass die menschliche Kognition ihrerseits im Rahmen der biologischen Evolution zu betrachten ist, ist in den kognitivistischen Literaturstudien weniger präsent. Karl Eibl hat sich diesem Defizit bereits 2004 in seinem Buch Animal poeta zugewandt, indem er die anthropologischen Grundlagen aus den neueren Entwicklungen in Soziobiologie und Evolutionärer Psychologie für einen literaturwissenschaftlichen Erkenntnisbedarf adaptierte und weiterentwickelte. Nach einer Folgestudie zum biologischen Kulturbegriff, die 2009 unter dem Titel Kultur als Zwischenwelt erschien, wendet Eibl sich mit diesem Buch nun spezifischer literarischen Phänomenen zu. Der einleitende Teil des Buches rekapituliert die Rahmentheorien für eine biologische Perspektive auf Sprache, Kultur und Ästhetik. In mehreren Kapiteln zu literarischen Formen und Figuren werden dann grundlegende Strukturphänomene erörtert, die sich aus biologisch verankerten Dispositionen ableiten lassen. So wird anschaulich gemacht, wie aus dem induktiven Erfahrungslernen die Möglichkeit zu metaphorischer Bildlichkeit hervorgeht und wie sich universale Plots auf kognitive Gestalterwartungen zurückführen lassen. Auch die Autorposition wird aus biologischer Perspektive betrachtet und als notwendige Instanz im menschlichen Kommunikationsverhalten mit den literaturtheoretischen Positionen zur Autorfrage vermittelt. Der letzte Teil des Buches setzt an bei einer Spezifik menschlicher Kognition, die als >Weltoffenheitkognitiver Imperativ
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 284
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 9
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783957430472
- Verschijningsdatum:
- 10/02/2016
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 154 mm x 233 mm
- Gewicht:
- 4318 g
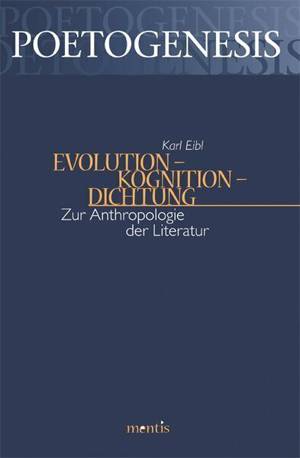
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 166 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.