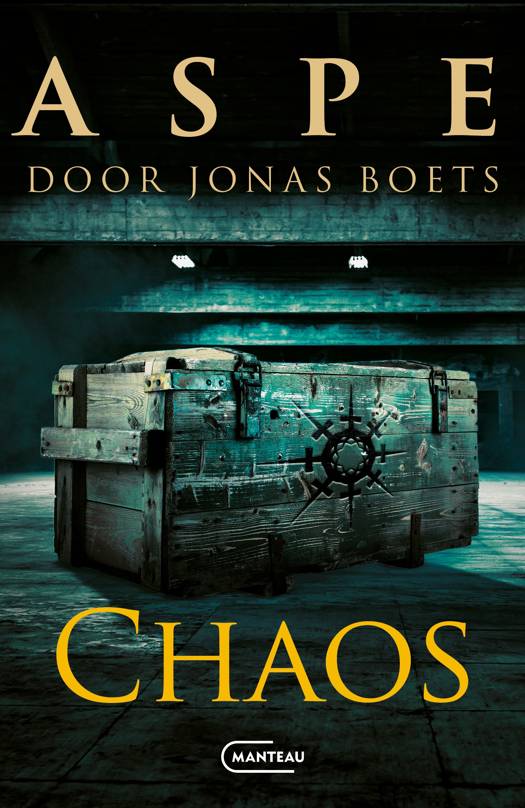- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Die Vermessung Der Kultur
Der 'Atlas Der Deutschen Volkskunde' Und Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1928-1980
Friedemann Schmoll
€ 117,95
+ 235 punten
Omschrijving
Der Atlas der deutschen Volkskunde zahlt zu den grossten geisteswissenschaftlichen Langzeitprojekten, die im 20. Jahrhundert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefordert wurden. Initiiert nach dem Ersten Weltkrieg betrieben Volkskundler mehrerer Generationen in den politischen Systemen der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus, der BRD und DDR die Vermessung und kartographische Erfassung einer durch Industrialisierung und Moderne gefahrdeten "Volkskultur". Getragen von gemeinschaftsstiftenden Erneuerungserwartungen und der Intention, deutschen "Volks- und Kulturboden" wissenschaftlich verlasslich zu dokumentieren, organisierte sich die junge und populare Volkskunde um dieses kartographische Grossprojekt als Wissenschaft. An uber 20 000 Orten inner- und ausserhalb des Deutschen Reiches wurden viele Millionen Daten zu Leben und Alltag, bauerlicher Arbeit, Sitte und Brauch, Festen und Ritualen, Ernahrung, religiosen Vorstellungswelten etc. gesammelt. Mit dem als Modellfall konzipierten Langzeitprojekt sollte auch die Rolle von Geistes- und Kulturwissenschaften in modernen Wissensgesellschaften zwischen Offentlichkeit, Politik und Wissenschaften neu definiert werden.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 331
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 5
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783515092982
- Verschijningsdatum:
- 31/03/2009
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 170 mm x 239 mm
- Gewicht:
- 561 g

Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 235 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.