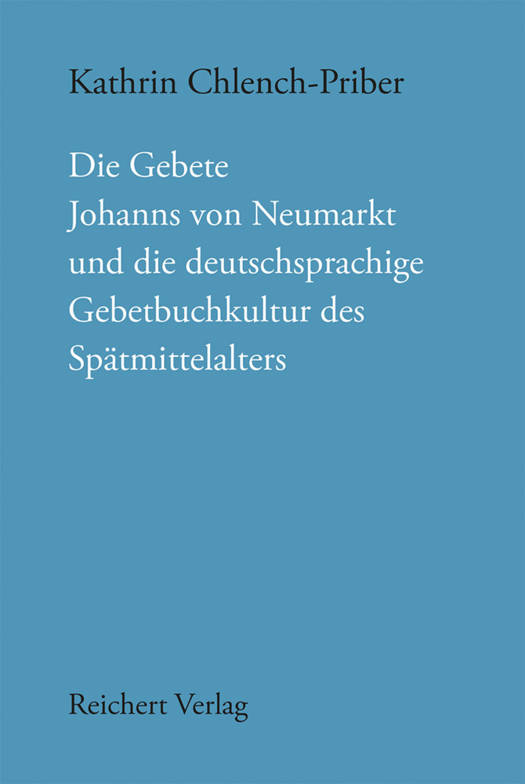Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Die Gebete Johanns Von Neumarkt Und Die Deutschsprachige Gebetbuchkultur Des Spatmittelalters
Kathrin Chlench-Priber
Hardcover | Duits | Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters | nr. 150
€ 212,95
+ 425 punten
Omschrijving
Die handschriftliche Uberlieferung deutschsprachiger Gebetbucher des Spatmittelalters setzt im 14. Jahrhundert ein. Etwa 40 Gebetbucher aus allen Teilen des deutschen Sprachraumes sind aus dieser Zeit uberliefert, bevor ihre Anzahl im 15. Jahrhundert eminent zunimmt. Johann von Neumarkt (um 1310-1380), Hofkanzler Karls IV. in Prag und Bischof von Leitomischel, spater Olmutz, wurde sowohl in der theologischen, historischen als auch germanistischen Forschung immer wieder als einer der Landmarks bezeichnet, der im Kontext des Prager Hofs die deutschsprachige Gebetbuchlandschaft nachhaltig gepragt habe. Jedoch bestand trotz dieser allgemein akzeptierten Einschatzung weder Einigkeit daruber, welche Gebete und Gebetbucher Johann von Neumarkt zuzuschreiben sind, noch worin sein Einfluss auf die Gebetbuchkultur bestanden habe. Die vorliegende Arbeit schliesst diese Forschungslucke. Durch eine umfangliche Sichtung der handschriftlichen Uberlieferung wurde in einem ersten Schritt das Gebetskorpus bestimmt, das im Spatmittelalter unter dem Namen Johann von Neumarkt firmierte. Eine eingehende Untersuchung der Materialitat der altesten Uberlieferungszeugen ergab, dass am Anfang der Uberlieferung ein Autorkorpus in Form von thematisch bestimmten Gebetsheftchen stand. Dieser nach dem Autorprinzip organisierte Gebetbuchtypus, der bislang noch nicht beschrieben wurde, ist in seiner Form mit Uberlieferungstypen der Lyrik- und Kleinepik vergleichbar und ordnet sich den Regeln des zeitublichen Literaturbetriebs ein. Im Gegensatz zur Literarizitat von Lyrik und Epik kommt der der Gebete jedoch eine an die Textsorte gebundene, spezifisch religiose Funktion zu, deren Eigenheiten sich aus theolinguistischer Perspektive beschreiben lassen. In diesem Zusammenhang spielen insbesondere die in den Gebeten gewahlte Sprache, ihre Verstandlichkeit, aber auch ihre Stilistik und die Kommunikationssituation beim performativen Vollzug des Gebets eine besondere Rolle. Diese Aspekte, uber die Johann von Neumarkt bereits zum Teil reflektierte, bieten den Rahmen, um die Spezifika des Gebetsstils fur seine Gebetsubersetzungen nach lateinischen Vorlagen oder freieren Gebetsubertragungen herauszuarbeiten. Zudem werden die Gebete inhaltlich analysiert und unter frommigkeitsgeschichtlichen Aspekten kontextualisiert sowie in die Gebetbuchlandschaft des Spatmittelalters eingeordnet.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 432
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 150
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783954904341
- Verschijningsdatum:
- 7/10/2020
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 155 mm x 230 mm
- Gewicht:
- 771 g
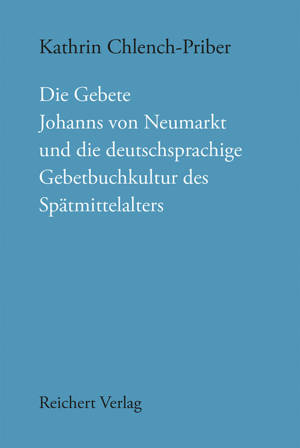
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 425 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.