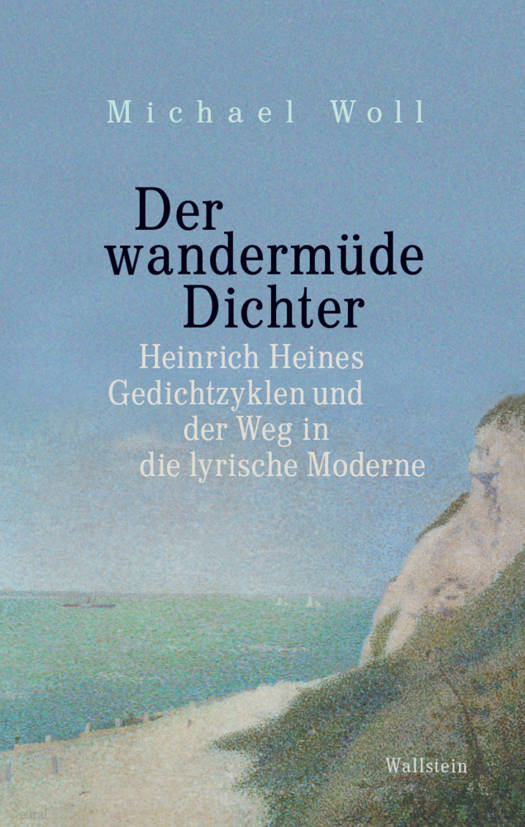Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Der wandermüde Dichter
Heinrich Heines Gedichtzyklen und der Weg in die lyrische Moderne
Michael Woll
Hardcover | Duits
€ 35,45
+ 70 punten
Omschrijving
Der erbitterte »Streit um Heine« ist längst vorüber, doch seine Lyrik wird bis heute unterschätzt: Wiederzuentdecken sind Gedichtzyklen, deren poetische Verfahren weit ins 20. Jahrhundert weisen.Heinrich Heine ist unbestritten einer der wichtigsten und international berühmtesten deutschsprachigen Dichter - und wird doch als moderner Lyriker unterschätzt. Als sein Verdienst gilt, die lyrische Dichtung vom goethezeitlichen Podest geholt und ihre Sprache aktualisiert zu haben, sodass sie Sehgewohnheiten abbilden und einer zeitkritischen Stimme Gehör verschaffen kann. Dieses Buch nimmt eine ganz andere Seite in den Blick, indem es zeigt, wie die Texte durch die Konstruktion eigengesetzlicher Welten schon in den 1820er Jahren Verfahren entwickeln, die die europäische Lyrik bis ins 20. Jahrhundert prägen werden. Die »Nordsee«-Zyklen entwerfen einen Reflexionsraum, der direkt in die Sprachwelten des französischen Symbolismus hätte führen können und der eine Zeitlang Heines Werk als Ganzes leitet, auch die oft mit der Präzision von Prosagedichten gearbeiteten Feuilletons. In der Lyrik findet Heine auch einen Modus, über das Exil als bewussten Abschied aus der Nationalliteratur nachzudenken. Lange hat er die Hoffnung, »Paris« ins Zentrum dieser lyrischen Welt zu stellen: Dafür lässt er die Nordsee bis an die Gare Saint-Lazare rauschen. Mit zunehmend illusionslosem Blick auf das Publikum verliert sich die Idee im Spätwerk - und ist heute wiederzuentdecken.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 336
- Taal:
- Duits
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783835360006
- Verschijningsdatum:
- 15/03/2026
- Uitvoering:
- Hardcover
- Afmetingen:
- 140 mm x 222 mm
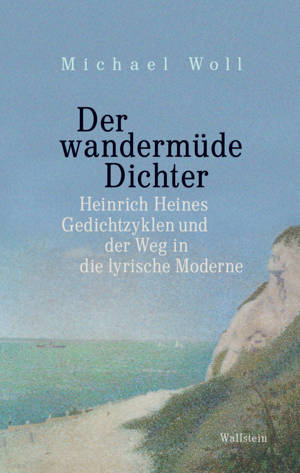
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 70 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.