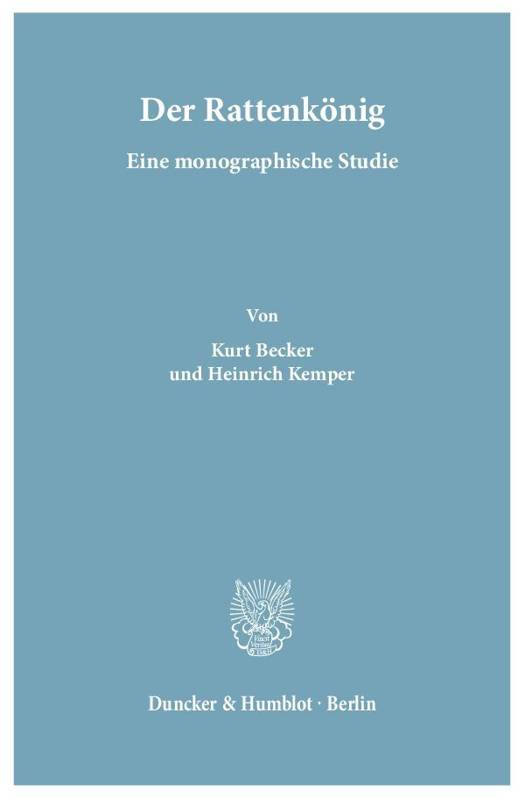- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Omschrijving
Der deutsche Name Rattenkönig (früher meistens Ratzenkönig oder Razenkönig) wurde - und wird vereinzelt auch heute noch - häufig, oder doch mehrfach in vielerlei verschiedenem Sinne gebraucht, und zwar
1. für eine besonders große Ratte, die andere Ratten beherrscht und von diesen gefüttert wird,
2. (metaphorisch) für einen Menschen, der auf Kosten seiner Mitmenschen ein üppiges Leben führt,
3. für eine Anzahl von Ratten, deren Schwänze so verknotet sind, daß die Tiere sich nicht mehr voneinander trennen können,
4. (metaphorisch) für eine sehr verwickelte Angelegenheit.
Vereinzelt fanden wir im Schrifttum auch noch andere Sinngebungen für "Rattenkönig". Bei Dornseiff (1943) ist es ein Synonym von "Unordnung", bei Kaltschmidt (1843) und Schulz (1845) eine rattenfressende oder -tötende Ratte (in ähnlichem Sinne wird auch die Bezeichnung "Rattenwolf" verwendet, vgl. Becker 1949), in der Reformationszeit als Schimpfwort zusammen mit "Wolf, Sau, Bock, Hunt, Katz und Schneck", eines der "wilden, unflätigen Tiere" (Schade 1863), bei Wilhelm Raabe ein heimtückischer Mensch (Trübner 1939) und schließlich bei ken (1838) ein Rattennest.
Aus dem Kapitel "Etymologie, Phraseologie und Folklore", S. 9-10
1. für eine besonders große Ratte, die andere Ratten beherrscht und von diesen gefüttert wird,
2. (metaphorisch) für einen Menschen, der auf Kosten seiner Mitmenschen ein üppiges Leben führt,
3. für eine Anzahl von Ratten, deren Schwänze so verknotet sind, daß die Tiere sich nicht mehr voneinander trennen können,
4. (metaphorisch) für eine sehr verwickelte Angelegenheit.
Vereinzelt fanden wir im Schrifttum auch noch andere Sinngebungen für "Rattenkönig". Bei Dornseiff (1943) ist es ein Synonym von "Unordnung", bei Kaltschmidt (1843) und Schulz (1845) eine rattenfressende oder -tötende Ratte (in ähnlichem Sinne wird auch die Bezeichnung "Rattenwolf" verwendet, vgl. Becker 1949), in der Reformationszeit als Schimpfwort zusammen mit "Wolf, Sau, Bock, Hunt, Katz und Schneck", eines der "wilden, unflätigen Tiere" (Schade 1863), bei Wilhelm Raabe ein heimtückischer Mensch (Trübner 1939) und schließlich bei ken (1838) ein Rattennest.
Aus dem Kapitel "Etymologie, Phraseologie und Folklore", S. 9-10
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 145
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 2
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783428000746
- Verschijningsdatum:
- 18/08/2014
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 155 mm x 231 mm
- Gewicht:
- 1896 g
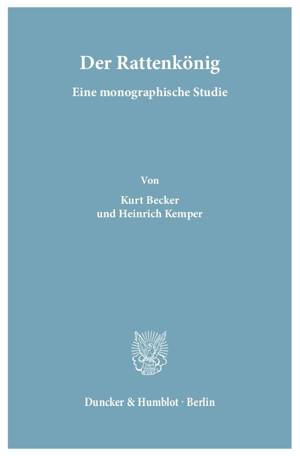
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 78 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.