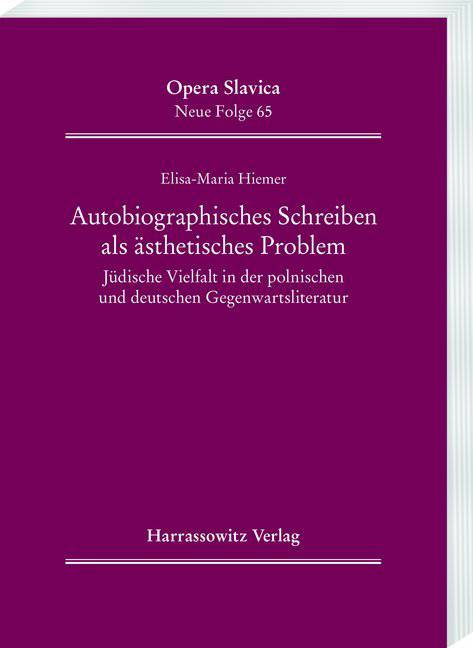Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- In januari gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Zoeken
Autobiographisches Schreiben ALS Asthetisches Problem
Judische Vielfalt in Der Polnischen Und Deutschen Gegenwartsliteratur
Elisa-Maria Hiemer
€ 120,95
+ 241 punten
Omschrijving
Judische Literatur = Holocaustliteratur? Die Rezeption von Werken judischer Autorinnen und Autoren scheint vom historischen Wissen um das Schicksal der fruheren Generationen untrennbar, vor allem wenn der Text autobiographische Bezuge nahelegt. Zudem erfolgt seitens der Forschung in der Regel eine Einordnung der Texte in das Uberlebenden-Narrativ der Schoah. Elisa-Maria Hiemers narratologisch angelegte Studie hinterfragt diese Praxis und untersucht anhand von vier Beispielen aus der polnischen (Piotr Pazinski, Agata Tuszynska) und der deutschen Literatur (Lena Gorelik, Channah Trzebiner) wie fiktionale, fiktive und abstrakte sowie authentizitatsstiftende Elemente die autobiographische Auseinandersetzung mit dem Judentum gestalten. Diese exemplarischen Positionen zum Judischsein werden sowohl aus der Sicht der Gattungsforschung beleuchtet als auch auf dem Hintergrund der gesellschaftlichen und literarischen Entwicklungen in beiden Landern betrachtet. Trotz der unterschiedlichen Tendenzen in Polen und Deutschland nach 1989 zeichnen sich gemeinsame Themen in den Werken ab. Sie befassen sich nicht nur mit dem erstarkenden Antisemitismus und der Sicht der Enkelgeneration, sondern treten fur ein pluralistisches Bild des Judentums ein und begeben sich auf die Suche nach individuellen zukunftsfahigen Konzepten fur den Umgang und den Stellenwert des eigenen Judischseins.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 212
- Taal:
- Duits
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 65
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783447112260
- Verschijningsdatum:
- 17/04/2019
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 171 mm x 242 mm
- Gewicht:
- 452 g
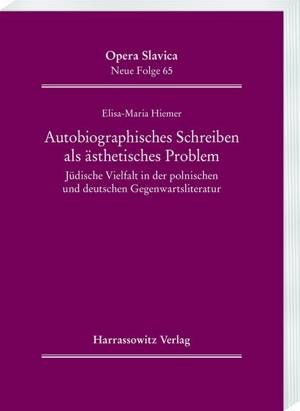
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 241 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.